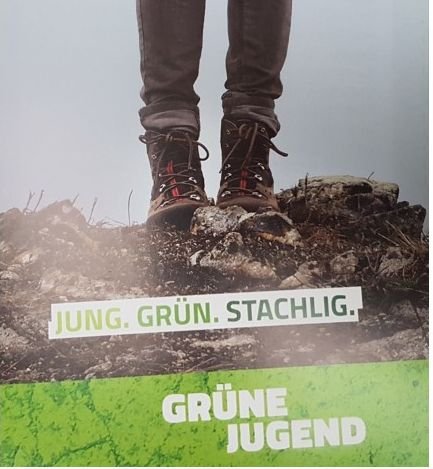GRÜNE Regionalratsfraktion stimmt 1. Regionalplanänderung zu
Die 1. Regionalplanänderung Wind/Erneuerbare Energie glich einer Herkules-Aufgabe.
Fachplaner, Regionalrat, Kreise, Kommunen und Naturschutzverbände haben in einem
knappen Zeitrahmen versucht, den Ausbau der Erneuerbaren Energien so verträglich
wie möglich umzusetzen.
„Wir haben um das Kriterienset für ganz OWL als Basis einer rechtssicheren
Regionalplanung hart gerungen und hätten uns an einigen Stellen eine andere
Gewichtung gewünscht“, berichtet Helga Lange, Vorsitzende der GRÜNEN
Regionalratsfraktion. Die Mehrheit des Regionalrates bestand aber darauf,
nur so viele Flächen in den Suchraum aufzunehmen, wie absolut notwendig.
Als Folge davon mussten letztlich auch Flächen als Windenergiebereiche dargestellt
werden, die bedeutende Schutzfunktionen aufweisen. Das kritisieren wir.
Dennoch ist diese Regionalplanänderung unter dem Strich ein akzeptabler Kompromiss,
den wir mittragen können. Eine Ablehnung würde zu einem ungesteuerten Wildwuchs in
ganz OWL führen.
„Wir sehen diese Regionalplanänderung als Chance, um mit einem geordneten Ausbau
der Windenergie in OWL einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten “,
so Lange weiter.
Positive Beispiele wie die Bürgerstiftung Dollenkamp für Brakel-Schmechten zeigen,
dass der Ausbau verträglich geschehen kann und wie alle Bürgerinnen und Bürger
vor Ort durch das neue Bürgerwindgesetz profitieren können.
Dieses Gesetz verpflichtet Vorhabenträger den Kommunen und den Menschen vor Ort
eine finanzielle Beteiligung anzubieten. So kann Wertschöpfung in der Region erfolgen,
insbesondere in den ländlichen Bereichen des Hochstifts Paderborn-Höxter.
Wir begrüßen, dass die Beschleunigungsflächen statt 99% nur noch 53,7% der
Gesamtfläche einnehmen und damit auf den neu ausgewiesenen Flächen weitere
tiefergehende Umweltprüfungen erfolgen müssen.
Alle Kommunen, die über den Regionalplan hinaus als „Positivplanung“ Flächen
für Windkraft oder Freiflächen-Photovoltaik ausweisen möchten, können und sollen
dies auch künftig tun.
Bereits in zwei Jahren wird im Rahmen eines Monitorings überprüft, ob und wo
nochmals nachgesteuert werden muss und kann.
Mit dem Feststellungbeschluss vom 24.03.2025 leistet OWL einen wichtigen Beitrag
zum Ausbau der Erneuerbaren Energien hin zu einer klimaneutralen Region.
Tour zur Salzabraumhalde Monte Kali bei Heringen
Weserversalzung und kein Ende? Was hat es mit dem Abraum auf sich und wie sieht das Erbe des Konzerns K+S in Hessen aus? Eingeladen von hessischen Grünen machte sich eine Gruppe aus Ostwestfalen-Lippe auf, die gigantischen Hinterlassenschaften des Salzbergbaus persönlich in Augenschein zu nehmen.
Am Fuße des fast 520 Meter hohen Kali-Berges bei Heringen wurde die Gruppe, zu der auch Pressevertreter gehörten, vom Werksleiter Christoph Wehner und von der stellv. Vorsitzenden der GRÜNEN Landtagsfraktion Hessen, Sigrid Erfurth begrüßt. Es entspann sich eine muntere Diskussion über die verabredeten Maßnahmen, wie man in Zukunft weniger Salz in Werra und Weser einleiten könne.
Im Zentrum dieses so genannten „Masterplan Salz“ stehen drei zentrale Schritte: Zur Reduktion der Salzbelastung sollen eine Kainit-Kristallisations-Flotationsanlage, die komplette Abdeckung aller Halden und das Einstapeln von verfestigten Rückständen unter Tage beitragen. Die Versenkung von Salzlauge in den Untergrund zum Schutz von Grund- und Trinkwasser soll 2021 enden. 2018 wird dann entschieden, ob die Abwässer damit soweit reduziert werden können, dass die temporäre Pipeline an die Oberweser überflüssig wird.
Herr Wehner erläuterte die skeptische Sicht von K+S auf den Masterplan Salz. So sei es sehr fraglich, ob das mit der Haldenabdeckung ab dem Jahr 2021 wie angedacht funktioniere und nur wenn es das tue, dann könnte man auch auf die Oberweserpipeline verzichten, erläuterter Herr Wehner die Sicht des Konzerns. Auch dass flüssige Produktionsabwässer wieder zurück in die Gruben gebracht werden solle, sehe der Konzern eher kritisch. Der Grund sei das ungesättigte Magnesiumchlorid, welches die stehen gelassenen Säulen in der Grube angreifen könne. Eine Erprobung sei aktuell in Thüringen genehmigt. Aber mit seinem Auftreten bestätigte er den Umschwung im Management des Unternehmens K+S, dass man bereit sei zu einer verbesserten Kommunikation mit Ländern und Anrainern.
„Wir kämpfen seit Jahrzehnten um die Weser und darum, dass endlich der Fluss salzfrei wird“ entgegnete Geschäftsführerin Martina Denkner und legte nach „es kann doch nicht sein, dass außerhalb von OWL das Salz in die Weser geleitet wird und wir nichts dagegen tun können. Unsere Einwände sind immer ignoriert worden. Antworten von K+S gab es nicht. “
Herr Wehner ging auch eine geplante Verdampfungsanlage ein. Mit der Firma K-UTEC stehe man in Kontakt. Aber die Preisvorstellungen seien sehr unterschiedlich. Während K-UTEC von einer halben Milliarde ausgehen, rechnet K+S mit fast der dreifachen Summe. Für das Unternehmen zähle, dass man nach der Verdampfung ein verkaufsfähiges Produkt hat, ansonsten könnte man mit dem Endprodukt nichts anderes anfangen, als es ebenfalls auf die Halde zu werfen. Zu den Gerüchten über einen zweiten Übernahmeversuch konnte der Unternehmensvertreter nichts sagen, verwies aber darauf, dass das Kali in Deutschland noch anderen Verwendungszwecken zugeführt werden könnte und deshalb einen anderen Marktwert habe.
Anschließend bestieg die Gruppe den Abraumberg. Bergführer Walter Mehnert, den Grünen nicht so grün, zeigte sich sehr diplomatisch und voller Anekdoten. Dem „Monte Kali“ gewann er auch Positives ab. Denn wenn der Berg nicht hier wäre, wäre das Material wohl in die Flüsse geleitet worden. Rüstig ging es steil bergauf auf fast 520 Meter Höhe. Höher dürfe der künstliche Abraumberg auch aus Flugsicherheitsgründen nicht werden. Die Gruppe konnte weit in die Runde blicken, musste dann aber vor dem aufkommenden Regen den Abstieg wagen
Steckbrief Monte Kali: Mai 2016
Beginn der Aufhaldung: 1976 mit Einführung des ESTA-Verfahrens
Zeitliche Begrenzung der Genehmigung: Die genehmigte Fläche (Genehmigung aus dem Jahr 1995) ist voraussichtlich 2018 erschöpft. Eine Haldenerweiterung ist erforderlich.
Genehmigte Höhe über Normalnull (Meeresspiegel): 520 Meter
Isthöhe über Normalnull (Meeresspiegel): 500 bis 510 Meter
Höhe über Grund: 100 bis 250 Meter
Überschüttete Fläche: Etwa 97,5 Hektar
Fläche des Haldenplateaus: Etwa 20 Hektar
Masse: Etwa 201 Millionen Tonnen
Aufhaldungsmenge pro Stunde (ausgenommen Förderpausen): etwa 900 Tonnen
Aufhaldungsmenge pro Jahr: 7,2 Millionen Tonnen
Belegschaft: 17 Personen
Wikipedia: Pro Tonne gewonnenem Kali entstehen mehrere Tonnen Abraumsalz. Das Abraumsalz besteht zu 96 % aus Kochsalz.
Quelle: (http://www.kalimuseum.de/monte_kali/zahlen_daten_fakten/information_und_zahlen_zum_monte_kali.html)

GRUENE.DE News
<![CDATA[Neues]]>
-
Stromsteuer bleibt, Gasprofite steigen – Schwarz-Rot setzt falsche Prioritäten
Die neue Bundesregierung versprach, die Energiekosten für alle zu senken – doch stattdessen steigen die Preise weiter, während Milliarden aus [...]
-
Endlich Schluss mit Konzernklagen gegen Klimaschutz
Heute wird ein Meilenstein für den Klimaschutz gesetzt, für den wir GRÜNE während unserer bündnisgrünen Regierungszeit in der Bundesregierung [...]
-
Weltflüchtlingstag: Mehr Solidarität und Verantwortung
Heute ist Weltflüchtlingstag. Im Jahr 2024 waren weltweit rund 123,2 Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen – ausgelöst durch [...]